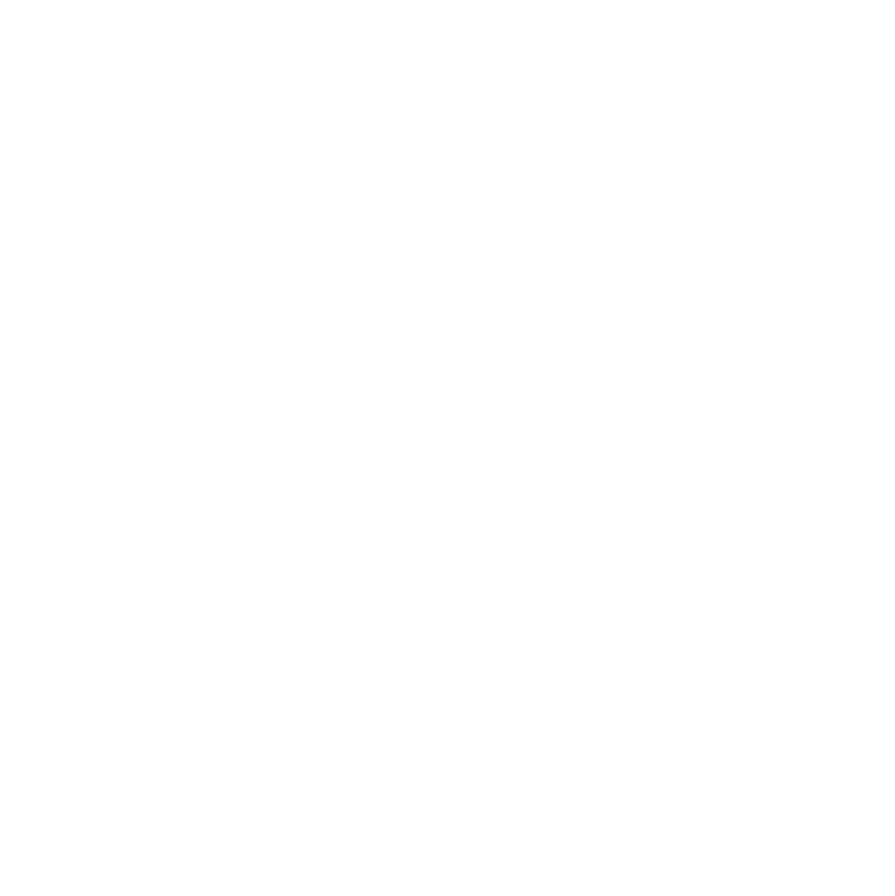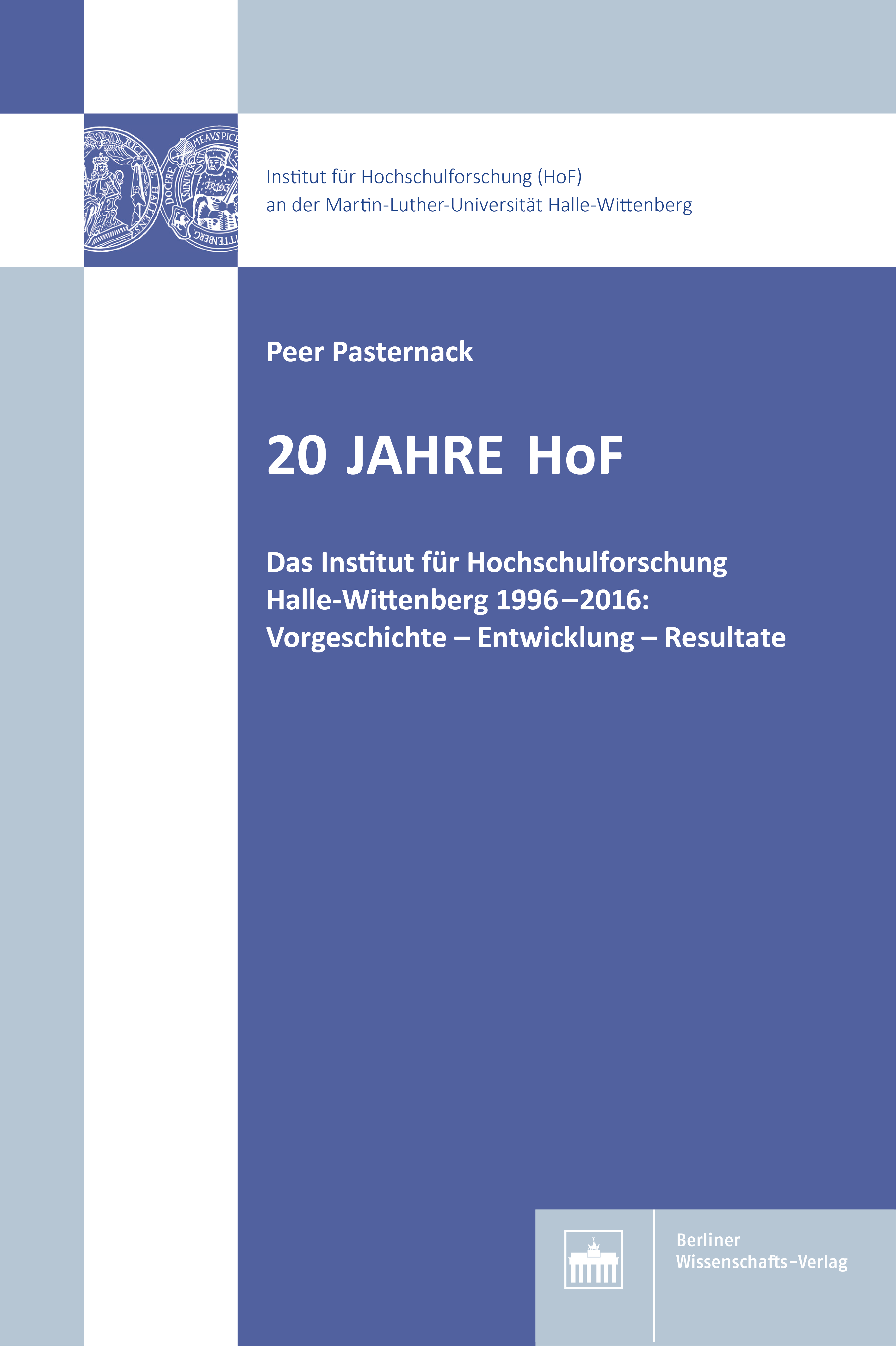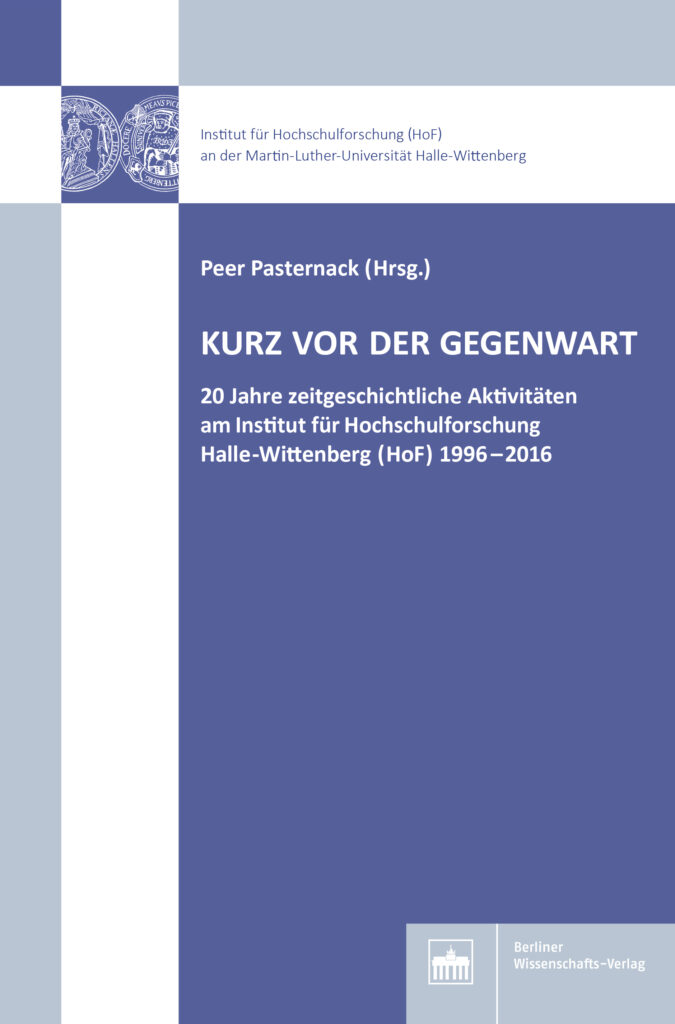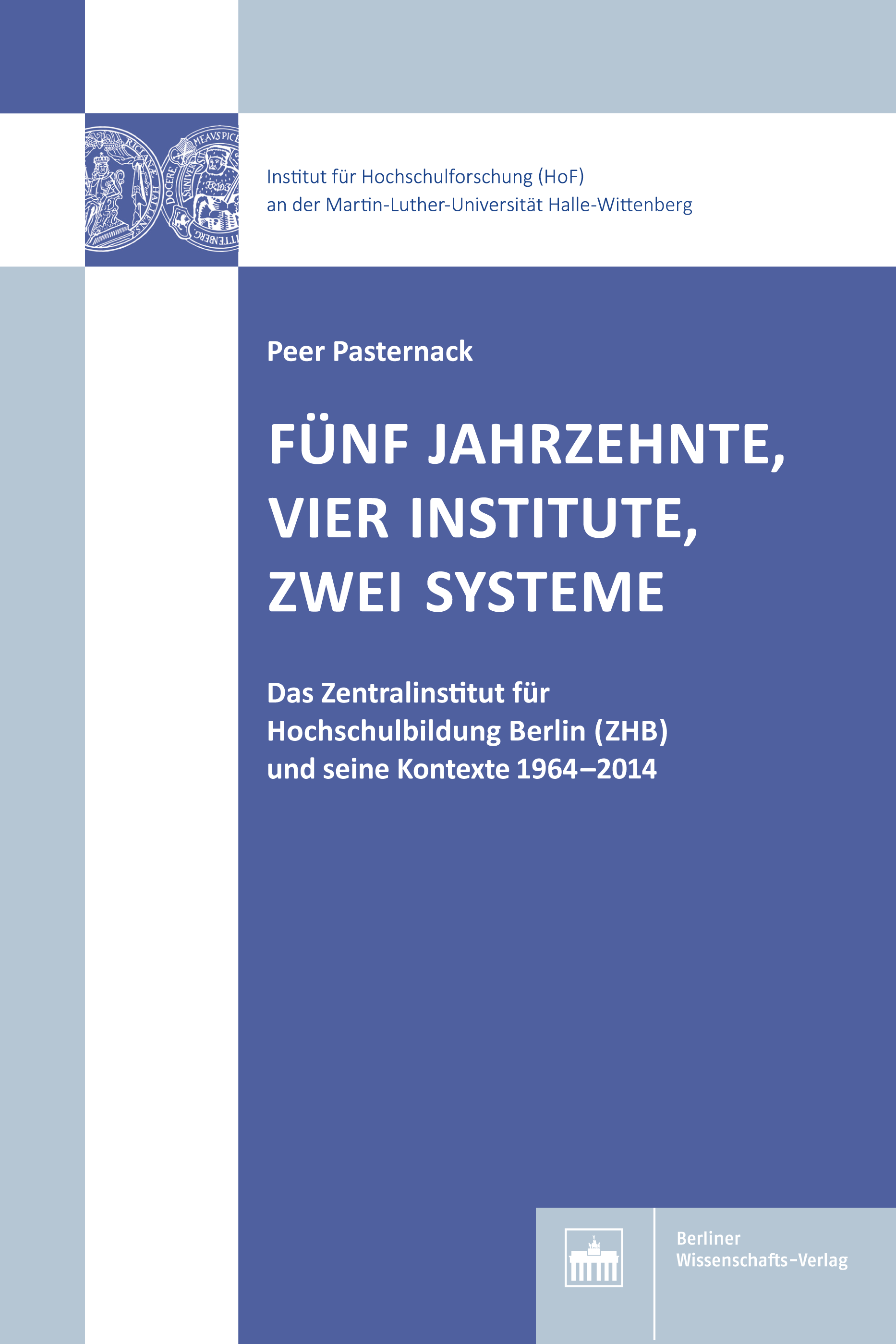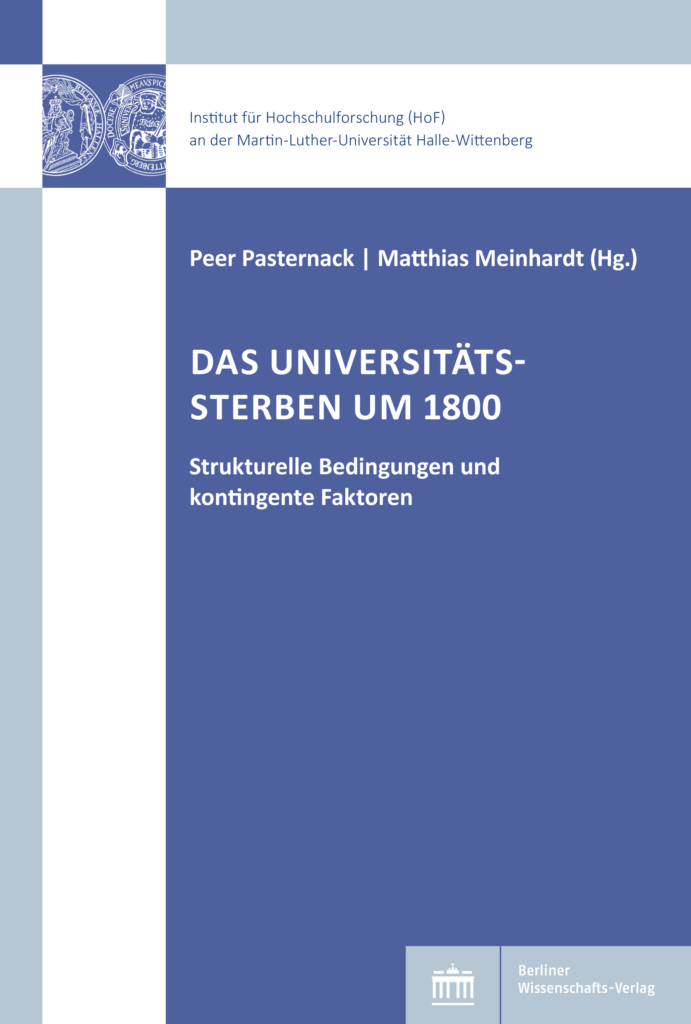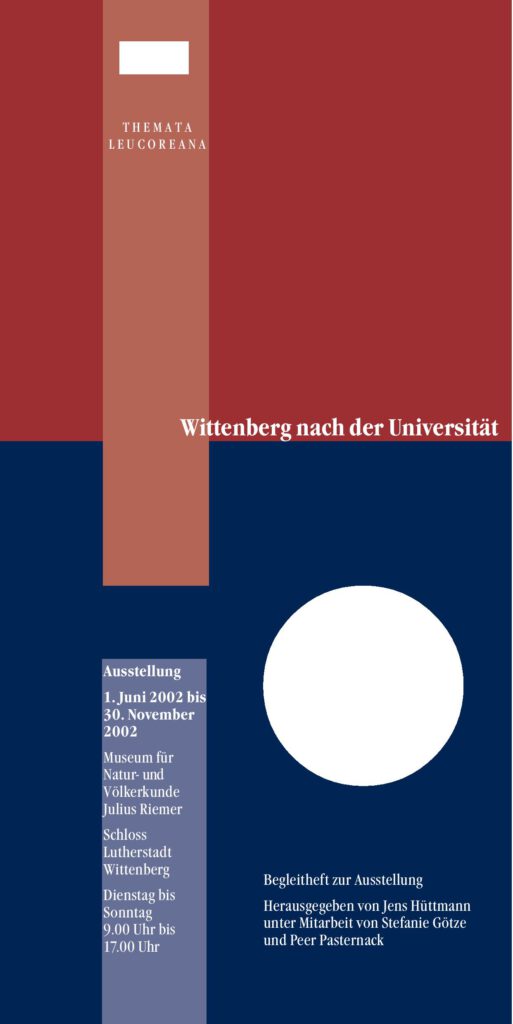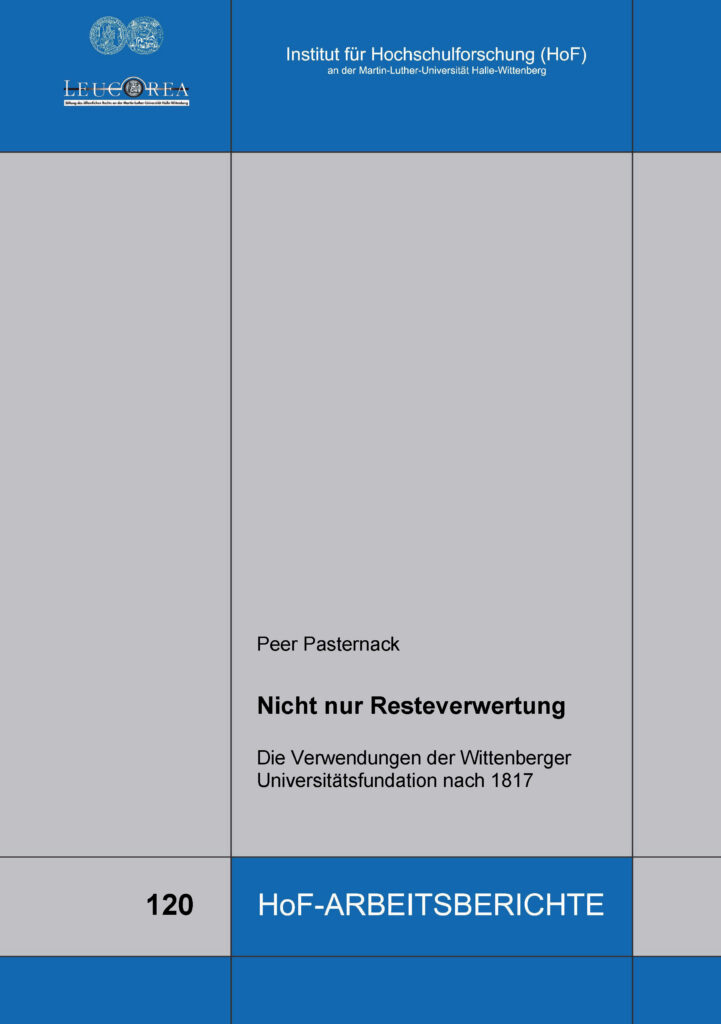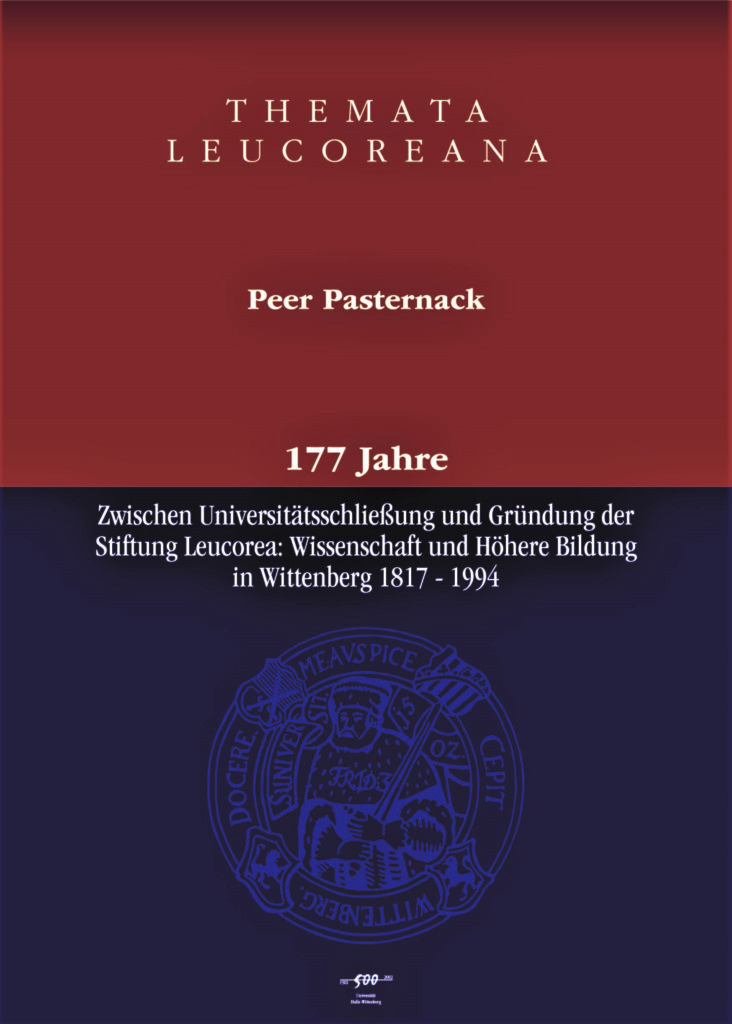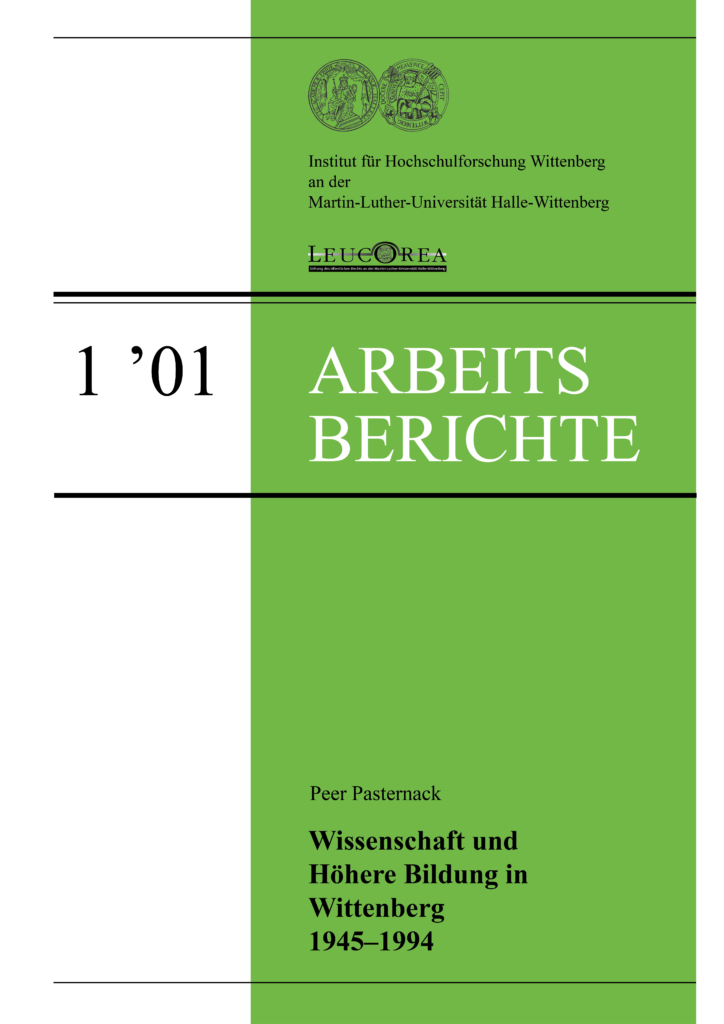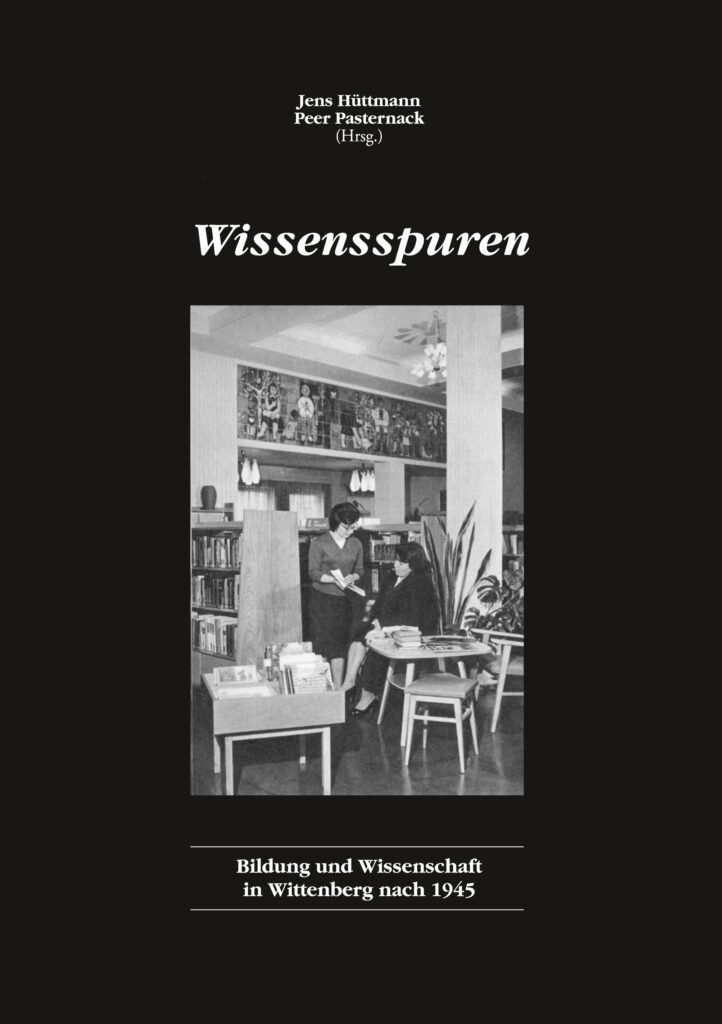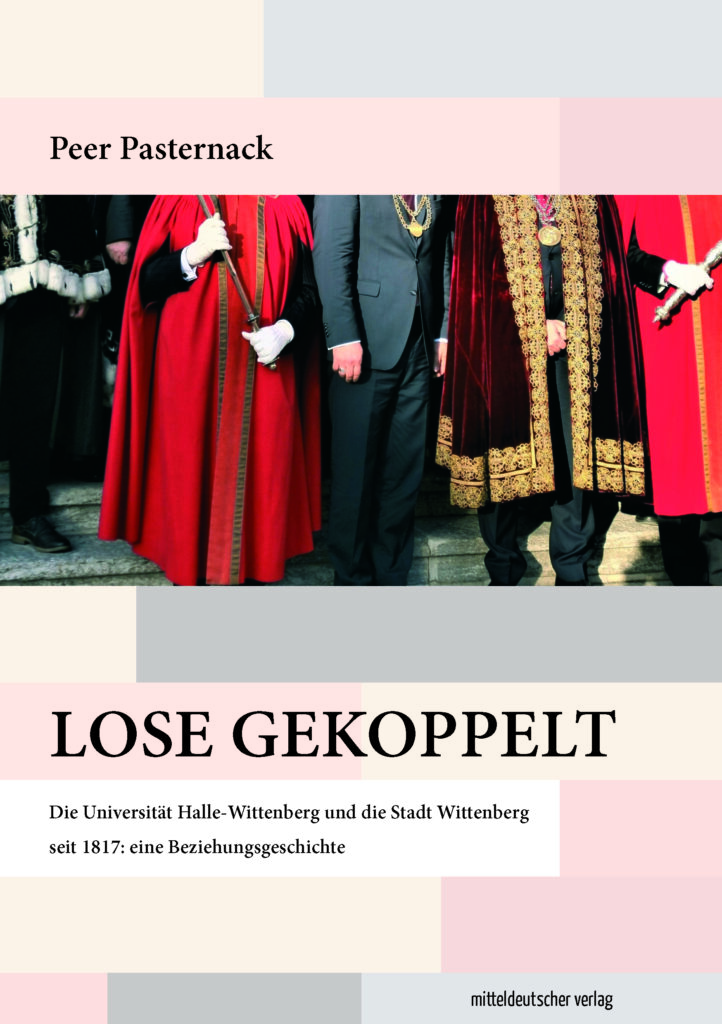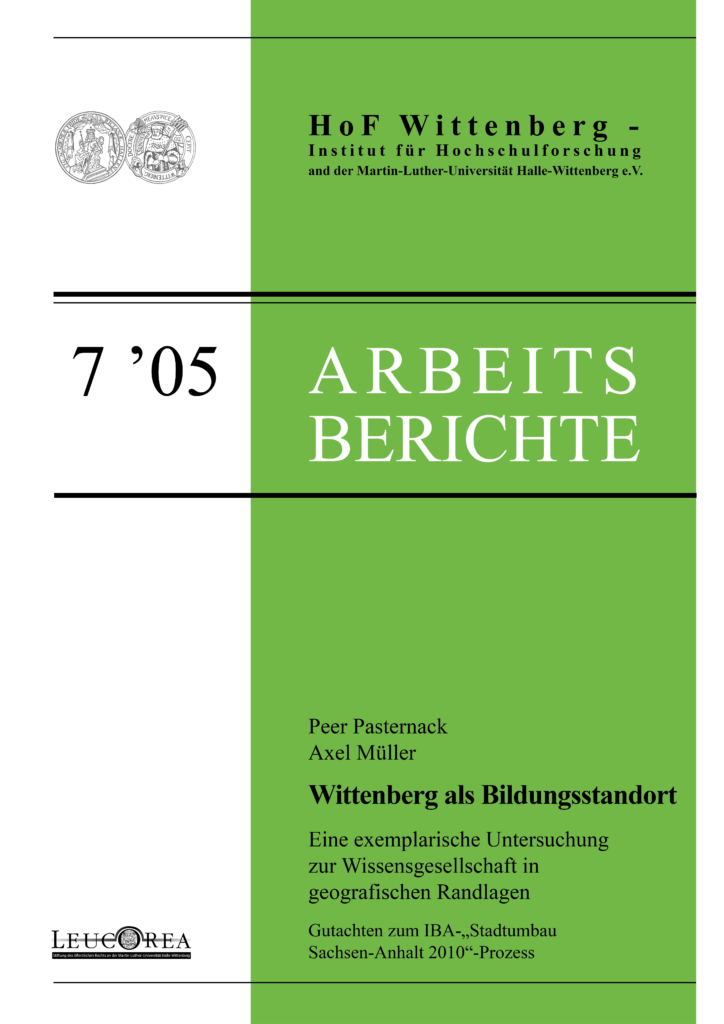Das Institut befasst sich überwiegend mit der Erforschung aktueller Hochschulreformen und Wissenschaftsentwicklungen. Dabei widersteht es einer Versuchung, die der Sitzort Wittenberg nahelegen könnte: Es wird keine örtliche Traditionslinie konstruiert – beginnend beim Bildungs- und Hochschulreformer Philipp Melanchthon, sich fortsetzend mit einzelnen Wittenberger Vertretern der Mitteldeutschen Aufklärung, die auch Ideen zur Neugestaltung akademischer Studien formulierten, und dann gleichsam kulminierend in der Etablierung eines Instituts für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
Für die Konstruktion einer solchen Linie waren die Wittenberger Entwicklungen zu erratisch und wechselhaft. Genau deshalb aber hat HoF diese Entwicklungen selbst untersucht. Denn das fügt sich in das Forschungsprofil des Instituts: Es analysiert Zusammenhänge und Kollisionen, Auf-, Um- und Abbrüche, die in den Überlappungsbereichen von Hochschul-, Wissenschafts-, Zeitgeschichts-, Bildungs- und Regionalentwicklungen bestehen und entstehen. HoF ist als An-Institut der Martin-Luther-Universität assoziiert.
HoF-Homepage: Informationen zu News, Arbeitsschwerpunkten und Mitarbeiter.innen, mit umfangreichem Open-Access-Archiv der HoF-Publikationen
Institutsgeschichte
Peer Pasternack: 20 Jahre HoF. Das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg 1996–2016: Vorgeschichte – Entwicklung – Resultate, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016
Das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) war eine Gründung gegen mancherlei Wahrscheinlichkeiten. Warum und wie es dennoch 1996 zu dieser Gründung kam und auf welcher Vorgeschichte sie aufbaute, verdient, erzählt zu werden. Auch die 20 Jahre danach halten reichlich Stoff für eine exemplarische Erzählung bereit: wie sich ein ‚Ost-Institut‘ als ein gesamtdeutsches zu konsolidieren vermochte, welche mehfachen Neuerfindungen seiner selbst es dabei zu bewerkstelligen hatte, wie sich Forschung jenseits der Bindung an eine Einzeldisziplin organisieren lässt, auf welche Weise sich ein Institut auf sein Sitzland einlassen kann, ohne darüber zum Regionalinstitut zu werden, und wie sich bei all dem externe und interne Turbulenzen produktiv wenden lassen.
Peer Pasternack (Hg.): Kurz vor der Gegenwart. 20 Jahre zeitgeschichtliche Aktivitäten am Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) 1996–2016, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2017
Das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) widmet sich seit seiner Gründung zwar vorrangig der forschenden Aufklärung gegenwartsbezogener Entwicklungen. Daneben aber hat es kontinuierlich auch zeithistorische Themen bearbeitet. Insgesamt wurden in den ersten 20 Jahren 52 Projekte zur Bildungs-, Hochschul- und Wissenschaftszeitgeschichte durchgeführt, deren Ergebnisse in 41 Büchern, 20 Forschungsberichten und 166 Artikeln dokumentiert sind. Das Buch fasst diese für jedes Projekt auf jeweils fünf Seiten zusammen. Die Themen reichen von den programmatischen Konzepten der Hochschulentwicklung in Deutschland seit 1945, dem Phänomen akademischer Rituale oder der Entwicklung der Hochschulbildungsbeteiligung in West und Ost seit 1950 über das Verhältnis von Politik und Wissenschaft in der DDR, den ostdeutschen Hochschulbau, die dortige wissenschaftliche Zeitschriftenlandschaft, den (Nicht-)Zusammenhang von Bildungs- und Beschäftigungssystem in der DDR, das dort existierende konfessionelle Bildungswesen, die DDR-Gesellschaftswissenschaften, Weiterbildung an DDR-Universitäten, den Spezialsektor der Militär- und Polizeihochschulen in der DDR, die künstlerischen Hochschulen daselbst und die Aufarbeitung der ostdeutschen akademischen Medizin nach 1989, desweiteren die Entwicklung privater Hochschulen seit 1950 im internationalen Vergleich, die 50jährige Geschichte des Schweizerischen Wissenschaftsrats oder die westdeutsche DDR-Forschung vor und die gesamtdeutsche DDR-Forschung nach 1989 bis hin zur ostdeutschen Wissenschaftstransformation ab 1990 und dem Umgang der Hochschulen mit ihrer Zeitgeschichte – sowie zahlreichen weiteren Themen.
Peer Pasternack: Fünf Jahrzehnte, vier Institute, zwei Systeme. Das Zentralinstitut für Hochschulbildung Berlin (ZHB) und seine Kontexte 1964–2014, BWV – Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2019
50 Jahre Forschung über Hochschulen im Osten Deutschlands: 1964 war das Institut für Hochschulpolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin gegründet worden. 2014 war das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) in seiner heutigen Form inhaltlich und organisatorisch konsolidiert. Dazwischen lagen noch zwei weitere Institute, sehr unterschiedliche Umfeldentwicklungen und mehrere krisenhafte Situationen, darunter ein Wechsel des Gesellschaftssystems. Auf je eigene Weise waren alle vier Einrichtungen mit ihren Vorgängern bzw. Nachfolgern verknüpft. Zu verfolgen sind organisatorische, kulturelle und inhaltliche Kontinuitäten wie Brüche innerhalb zweier Gesellschaftssysteme und über den 1989er Systemwechsel hinweg: 25 Jahre vor und 25 Jahre nach der Implosion des DDR-Sozialismus.
HoF-Berichterstattungen zur Wittenberger Bildungsgeschichte
Das Institut für Hochschulforschung forscht nicht nur zur sog. Third Mission der Hochschulen (also dazu, wie Hochschulen nicht allein Forschung und Lehre betreiben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sich regional engagieren können). Es betreibt auch selbst diese Dritte Aufgabe als Community Engagement. Dazu gehören die HoF-Aktivitäten zur Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte Wittenbergs. Das hat bisher vor allem in zwei Ausstellungen, zwei Websites und einer Reihe von Publikationen seinen Niederschlag gefunden:
Peer Pasternack: Genius loci?, in: ders., 20 Jahre HoF. Das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg 1996–2016: Vorgeschichte – Entwicklung – Resultate, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, S. 14–22
Peer Pasternack / Daniel Watermann: www.uni-wittenberg.de, Institut für Hochschulforschung (HoF), Halle-Wittenberg 2021ff.
Peer Pasternack / Daniel Watermann: www.uni-wittenberg.de. Begleitheft zur Website, Institut für Hochschulforschung (HoF), Halle-Wittenberg 2020, 28 S.
Peer Pasternack / Daniel Watermann: Die LEUCOREA Wittenberg – Nach 204 Jahren endlich online: www.uni-wittenberg.de, in: Sachsen-Anhalt-Journal 2/2021, S. 23–24.
Seit es das Internet gibt, hat jede Institution, die etwas auf sich hält, eine eigene Website. Wer keine hat, existiert in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung im Grunde nicht – bzw. hat nicht existiert. Die Universität Wittenberg gibt es seit 1817 nicht mehr, und folglich gab es sie bisher virtuell nicht. Das marginalisierte sie, trotz ihrer historischen Bedeutung, im kulturellen Gedächtnis. Um dem abzuhelfen, wurde die Leucorea online gebracht.
Peer Pasternack / Daniel Watermann: Public History und Archiv verteilter Bestände. Webpräsenzen zur Universitätsgeschichte: Ein Werkstattbericht anhand der Website www.uni-wittenberg.de, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 24, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, S. 33–50
Peer Pasternack / Matthias Meinhardt (Hg.): Das Universitätssterben um 1800. Strukturelle Bedingungen und kontingente Faktoren, BWV – Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2024, 209 S. – Inhaltsverzeichnis und Einleitung
Inwiefern ist die Annahme überwiegend einheitlicher oder ähnlicher Ursachen für das Universitätssterben in den deutschen Ländern um 1800 angemessen? Immerhin waren im Verlaufe des Vierteljahrhunderts, die das Universitätssterben umfasste, die Umfeldsituationen sehr differenziert, die territorialen Bedingungen uneinheitlich und die internen Potenzen der Hochschulen unterschiedlich. Dazu versammelt dieser Band vier Perspektiven: die analytische Erschließung der Makro-Ebene der Hochschulentwicklung und -politik sowie dreierlei Arten von Falldarstellungen, nämlich zu um 1800 aufgelösten Universitäten, zu seinerzeit zwar gefährdeten, dann aber dennoch fortbestehenden Universitäten und zur Berliner Neugründung. Das Buch wurde gemeinsam von der Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek Wittenberg und dem Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) realisiert.
Peer Pasternack: Verstreut: Die Überlieferungssituation aus und zur Universität Wittenberg. Auffindbarkeit und Zugänge, in: ders., Das Sachsen-Anhalt-Wissen aus Wittenberg. Die HoF-Beiträge des letzten Jahrzehnts (2013–2022), Institut für Hochschulforschung (HoF), Halle-Wittenberg 2022, S. 128–133
Peer Pasternack / Daniel Watermann: Verstreut: Die Überlieferungssituation aus und zur Universität Wittenberg. Auffindbarkeit und Zugänge, in: Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt 2022, Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2022, S. 211–248
Peer Pasternack: Das Nachleben der Universität Wittenberg, in: Peer Pasternack/Matthias Meinhardt (Hg.), Das Universitätssterben um 1800. Strukturelle Bedingungen und kontingente Faktoren, BWV – Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2024, S. 183–205
Peer Pasternack: Wittenberg nach der Universität. Ein Forschungsprogramm am Institut für Hochschulforschung in der Leucorea, in: Heimatkalender Lutherstadt Wittenberg & Landkreis Wittenberg 2006, Wittenberg 2006, S. 77–86
Jens Hüttmann (Hg.): Wittenberg nach der Universität. Ausstellungskatalog, unt. Mitarb. v. Stefanie Götze und Peer Pasternack, Institut für Hochschulforschung, Wittenberg 2002, 35 S.
Zum 500. Gründungsjubiläum der Universität Wittenberg, 1817 in die Universität Halle überführt, hat HoF im Wittenberger Schloss eine Ausstellung zu „Wittenberg nach der Universität“ ausgerichtet. Beleuchtet wurden die – im einzelnen sehr unterschiedlich ausgefallenen – Kontinuitätsbrüche, welche die Stadt nach der Universitätsaufhebung 1817 erfahren hat. Sie sucht, die Brüche erfahrbar zu machen, indem Wittenberg als Ort theologischer Ausbildung, der medizinischen Ausbildung und Versorgung, als Ort des Rechts sowie als Ort propädeutischer Ausbildung und naturwissenschaftlicher Forschung vorgestellt wird – gekennzeichnet durch das Charakteristikum, all dies trotz Universitätsschließung im Jahre 1817 geblieben oder später wieder geworden zu sein.
Jens Hüttmann / Peer Pasternack (Hg.): Wittenberg nach der Universität. Eine historische Spurensicherung. Website, Institut für Hochschulforschung, Wittenberg 2003
Als Beitrag des Instituts für Hochschulforschung zum 500jährigen Gründungsjubiläum der Universität Halle-Wittenberg war 2002 im Wittenberger Schloss die Ausstellung „Wittenberg nach der Universität“ gezeigt worden. Die Netzpräsentation dieser Ausstellung bildet den Mittelpunkt der Online-Veröffentlichung. Erweitert ist dies um weitere Materialien zum Thema.
Peer Pasternack: Nicht nur Resteverwertung. Die Verwendungen der Wittenberger Universitätsfundation nach 1817, Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg 2022, 140 S.
Die Auflösung der Universität Wittenberg Leucorea 1817 (qua Vereinigung mit Halle) machte die Verwaltung ihrer Hinterlassenschaften nötig. Das betraf die sog. Wittenberger Fundation incl. der Leucorea-Immobilien. Dazu waren einerseits die Königliche Universitätsverwaltung zu Wittenberg und andererseits, in Halle (Saale), das Kollegium der Professoren der Wittenberger Stiftung gegründet worden. Sie kümmerten sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein um die materiellen und finanziellen Hinterlassenschaften der Leucorea. In einschlägigen Darstellungen waren beide bisher nur kursorisch und hinsichtlich des Gesamtzeitraums ihres jeweiligen Bestehens noch gar nicht behandelt worden. Daher ist hier erstmals deren Geschichte rekonstruiert worden.
Peer Pasternack: Nicht nur Resteverwertung. Die Verwaltung der Wittenberger Universitätsfundation nach 1817, in: ders., Das Sachsen-Anhalt-Wissen aus Wittenberg. Die HoF-Beiträge des letzten Jahrzehnts (2013–2022), Institut für Hochschulforschung (HoF), Halle-Wittenberg 2022, S. 122–127
Peer Pasternack: 177 Jahre. Zwischen Universitätsschließung und Gründung der Stiftung Leucorea: Wissenschaft und Höhere Bildung in Wittenberg 1817–1994, Stiftung Leucorea, Wittenberg 2002, 122 S.
1817 wurde die Wittenberger Universität aufgehoben und mit Halle vereinigt. Die Darstellung widmet sich der Zeit, in der Wittenberg kein universitärer Standort war. Unterschieden wird zwischen reformationsbezogenen und nichtreformationsbezogenen Aktivitäten: Welche Rolle spielte Wittenberg in den geschichtspolitischen Verarbeitungsversuchen der Reformation, und welche Entwicklung dabei die reformationshistorische Infrastruktur der Stadt Wittenberg? Inwiefern fortexistierte bzw. entstand Wissenschaft und Bildung nach der Universität – so aus Gründen der technologisch-industriellen Innovation oder der zunehmenden Verwissenschaftlichung zahlreicher gesellschaftlicher Bereiche, aus strukturpolitischen Gründen, die zur der Ansiedlung nichtuniversitärer Forschungs- und Bildungseinrichtungen führten, oder aus kulturellen Motiven?
Peer Pasternack: Wittenberg nach der Universität. Eine Stadt der Theologie, Medizin und Naturforschung, der Geschichtsschreibung und der Wissenschaftspropädeutik auch nach 1817, in: Zeitschrift für Heimatforschung Bd. 11(2002), S. 28–52
Jens Hüttmann / Peer Pasternack: Zentrale Peripherie. Bildung und Wissenschaft in Wittenberg nach 1817, in: Peer Pasternack (Hg.), Wissensregion Sachsen-Anhalt. Hochschule, Bildung und Wissenschaft: Die Expertisen aus Wittenberg, Akademische Verlagsanstalt, Leipzig 2014, S. 187–191
Uwe Grelak / Peer Pasternack: Evangelisches Predigerseminar Wittenberg, in: dies., Theologie im Sozialismus. Konfessionell gebundene Institutionen akademischer Bildung und Forschung in der DDR. Eine Gesamtübersicht, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, S. 116–118
Peer Pasternack: Wissenschaft und Höhere Bildung in Wittenberg 1945–1994, Institut für Hochschulforschung (HoF), Wittenberg 2001, 45 S.
In den letzten beiden Jahrhunderten war Wittenberg 177 Jahre lang eine Stadt ohne Universität. 1817 war die Universität Leucorea faktisch aufgehoben worden – administrativ vollzogen als Vereinigung mit der Friedrichs-Universität zu Halle/Saale. 177 Jahre später, 1994, erfolgte die Gründung der Stiftung Leucorea, die sich in der historischen Kontinuität zur Universität sieht. Sie operiert als eigenständig verwaltete Außenstelle der Universität in Halle, und als ihre wesentliche Aufgabe wurde formuliert, zur „Wiederbelebung akademischen Lebens in Wittenberg“ beizutragen. Von Interesse ist daher, woran diese Wiederbelebung vor Ort anknüpfen kann.
Peer Pasternack: Wissenschaft und Höhere Bildung in Wittenberg 1945–1994, in: ders. (Hg.), DDR-bezogene Hochschulforschung. Eine thematische Eröffnungsbilanz aus dem HoF Wittenberg, Beltz Verlag, Weinheim/Basel 2001, S. 73–108
Jens Hüttmann / Peer Pasternack (Hg.): Wissensspuren. Bildung und Wissenschaft in Wittenberg nach 1945, Drei-Kastanien-Verlag, Wittenberg 2004, 414 S.
1994 war in Wittenberg die Stiftung Leucorea gegründet worden. Sie hat seither den Auftrag, in Kooperation mit der Martin-Luther-Universität in Halle/S. den historischen Universitätsstandort in Wittenberg akademisch wiederzubeleben. Der Band liefert eine Bestandsaufnahme von Bildung und Wissenschaft in den fünf Jahrzehnten, die dieser Wiederbelebung vorangegangen waren. Unter den 37 Autorinnen und Autoren finden sich ebenso Wissenschaftler wie Zeitzeugen. Die zentralen Fragen sind: In welcher Weise partizipierten periphere Orte – im Unterschied zu den Metropolen – an der rasanten industrialisierungsbedingten Verbreiterung von Qualifikationserfordernissen, Bildungsbedürfnissen und Verwissenschaftlichungstendenzen? Und wie sind die diesbezüglichen Ausgangsbedingungen für eine Einbindung geografischer Randlagen in wissensgesellschaftliche Entwicklungen zu bewerten?
Peer Pasternack: Lose gekoppelt. Die Universität Halle-Wittenberg und die Stadt Wittenberg seit 1817: eine Beziehungsgeschichte, unt. Mitarb. v. Daniel Watermann, Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2024, 332 S. – Inhaltsverzeichnis und Leseprobe
Seit reichlich zwei Jahrhunderten trägt die hallesche Universität „Halle-Wittenberg“ im Namen: 1817 war die Universität Wittenberg LEUCOREA (gegr. 1502) in die heutige Martin-Luther-Universität (gegr. 1694) überführt worden. Ist die doppelte Ortsangabe „Halle-Wittenberg“ nur eine historische Reminiszenz? Oder hatte und hat sie auch praktische Bedeutungen für die hallesche Universität und die Stadt Wittenberg? Die Beziehungsgeschichte zwischen beiden wird hier erstmals nachgezeichnet. Wie sich herausstellt, waren die Verbindungen während der zurückliegenden zwei Jahrhunderte höchst wechselhaft.
Uwe Grelak / Peer Pasternack: Paul-Gerhard-Stift Wittenberg, in: dies., Das kirchliche Berufsbildungswesen in der DDR, Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin‐Luther‐Universität, Halle‐Wittenberg 2018, S. 69–71
Matthias Kopischke / Michael Beleites / Thorsten Moos / Peer Pasternack: Otto Kleinschmidt. Grenzgänger zwischen Naturwissenschaft und Religion, Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Wittenberg 2007, 12 S.
Otto Kleinschmidt (1870–1954) war der erste Leiter des 1927 gegründeten Kirchlichen Forschungsheims Wittenberg, Theologe und Zoologe, Weltanschauungspublizist und Ausstellungsmacher sowie Dozent am Evangelischen Predigerseminar in Wittenberg. Dass er all dies in drei verschiedenen politischen Systemen war – Weimarer Republik, Nationalsozialismus und SBZ/DDR –, macht sein Leben und Werk auch über den biografischen Einzelfall hinaus interessant.
Antje Schober: Otto Kleinschmidt – Theologe, Naturwissenschaftler, Rassenkundler, Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig/Institut für Hochschulforschung (HoF), Leipzig/Wittenberg 2005, 70 S.
Untersucht werden Otto Kleinschmidts (1870–1954) Weg von der Ornithologie zur Anthropologie, sein rassenkundlerisches Engagement vor dem Hintergrund der Etablierung der Rassenlehre und Rassenhygiene in Wissenschaft und Politik in den 1920er und 30er Jahren sowie Kleinschmidts Rassenkunde im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Wissenschaft im „Dritten Reich“.
Peer Pasternack: Stadtgeschichtliches Museum – Städtische Sammlungen, in: Jens Hüttmann/Peer Pasternack (Hrsg.), Wissensspuren. Bildung und Wissenschaft in Wittenberg nach 1945, Drei-Kastanien-Verlag, Wittenberg 2004, S. 209–221
Uwe Grelak / Peer Pasternack: Staatliche Lutherhalle Wittenberg, in: dies., Theologie im Sozialismus. Konfessionell gebundene Institutionen akademischer Bildung und Forschung in der DDR. Eine Gesamtübersicht, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, S. 239–242
Uwe Grelak / Peer Pasternack: Theologischer Arbeitskreis für reformationsgeschichtliche Forschung (TARF), in: dies., Theologie im Sozialismus. Konfessionell gebundene Institutionen akademischer Bildung und Forschung in der DDR. Eine Gesamtübersicht, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016, S. 190–191
Peer Pasternack: Die Spuren der LEUCOREA (1502–1817). Ein universitätshistorischer Stadtrundgang durch das heutige Wittenberg, Drei Kastanien Verlag, Lutherstadt Wittenberg 2023, 92 S. – Inhaltsverzeichnis und Leseprobe
Wittenberg atmet praktisch an jeder Ecke seiner Innenstadt den ‚Geist‘ der Universität, die hier von 1502 bis 1817 bestand. Daher lässt sich die LEUCOREA-Geschichte (und nebenbei Wittenberg selbst) sinnlich erschließen, indem man einen Rundgang unternimmt, der sich ausdrücklich auf die Suche nach Spuren der Universität im Stadtraum konzentriert. Dieser führt einerseits zu bekannten Orten, die jeder andere Stadtrundgang auch enthält. Andererseits macht er auf Zeugen aufmerksam, die ansonsten eher der Aufmerksamkeit entgehen.
Peer Pasternack: Wissenschaft und Höhere Bildung in der Peripherie. Zur Einordnung des Falls Wittenberg, in: Jens Hüttmann/Peer Pasternack (Hrsg.), Wissensspuren. Bildung und Wissenschaft in Wittenberg nach 1945, Drei-Kastanien-Verlag, Wittenberg 2004, S. 26–54
Peer Pasternack: Wissensnetze. Bildung und Wissenschaft in Wittenberg seit 1990, in: Jens Hüttmann/Peer Pasternack (Hrsg.), Wissensspuren. Bildung und Wissenschaft in Wittenberg nach 1945, Drei-Kastanien-Verlag, Wittenberg 2004, S. 383–408
Peer Pasternack / Axel Müller: Wittenberg als Bildungsstandort. Eine exemplarische Untersuchung zur Wissensgesellschaft in geografischen Randlagen, Institut für Hochschulforschung (HoF), Wittenberg 2005, 156 S.
Untersucht wird, welche Potenziale Wittenberg hat und ggf. entwickeln könnte, um sich explizit als Bildungsstandort zu profilieren. Dabei wird von dreierlei ausgegangen: Bildung und Bildungsangebote sollen zum ersten Teilhabechancen und Lebensqualität der ansässigen Wohnbevölkerung steigern, zum zweiten die Stadt überregional attraktivieren und zum dritten wirtschaftliche Effekte erzeugen. Dieser Betrachtung entsprechend werden konkrete Handlungsoptionen für Wittenberg entwickelt.
Uwe Grelak / Peer Pasternack: Lutherstadt Wittenberg: „Campus Wittenberg“, in: dies., Die Bildungs-IBA. Bildung als Problembearbeitung im demografischen Wandel: Die Internationale Bauausstellung „Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010“, Akademische Verlagsanstalt, Leipzig 2014, S. 93–117
Peer Pasternack: Wissensgesellschaft in der Peripherie. Wittenberg als Bildungsstandort, in: ders. (Hg.), Wissensregion Sachsen-Anhalt. Hochschulen, Bildung und Wissenschaft: Die Expertisen aus Wittenberg, Akademische Verlagsanstalt, Leipzig 2014, S. 52–58